Anhand von 5 Trends der Transformation hat Sophia von Rundstedt in ihrer Keynote auf der Workforce-Transformation-Konferenz neue Wege für Unternehmen aufgezeigt, um sich zukunftssicher aufzustellen und zugleich den Beschäftigten echte Perspektiven aufzuzeigen. Im Gespräch mit Rundstedt News erläutert die Geschäftsführerin, warum die Trends aus ihrer Sicht wegweisend sind.
Rundstedt News (RN): Frau von Rundstedt, die 5 Trends, die Sie in Ihrem Vortrag präsentiert haben, sind erstmalig von Ravin Jesuathasan und John W. Boudreau in ihrem Buch „Work without Jobs“ (2022) beschrieben worden. Müssen wir ins Ausland schauen, um Impulse für neue Wege zu erhalten?
Sophia von Rundstedt (SvR): Mein Eindruck ist, dass sich die tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt in den USA etwas drei bis fünf Jahre früher als bei uns abzeichnen. Wir erleben in Gesprächen mit Vorständen/Geschäftsführern, HR-Verantwortlichen und Arbeitnehmervertretungen, dass die im Buch beschriebenen Trends wie aufgabenbasierte Arbeit, die Entstehung einer Nahstelle von Mensch und KI oder zur dezentralen Steuerung für deutsche Unternehmen zunehmend Relevanz erhalten. Wenngleich die Veränderungen erst langsam im betrieblichen Alltag ankommen, sollten wir sie bereits heute antizipieren. Unsere Aufgabe ist es, die wichtigen Impulse aus Übersee an die Rahmenbedingungen unserer sozialen Marktwirtschaft, der Mitbestimmungskultur und des deutschen Arbeitsrechts anzupassen. Für die Workforce Transformation in der Bundesrepublik werden wir eigenständige Lösungen entwickeln müssen.
Trend 1: Vom festen Aufgabenprofil zur aufgabenbasierten Arbeit
RN: Dann lassen Sie uns die Trends noch einmal genauer anschauen: Demnach verlieren feste Jobprofile an Relevanz. An ihre Stelle tritt schrittweise die aufgabenbasierte Arbeit. Welche Auswirkungen hat dieser Trend für Unternehmen und Beschäftigte?
SvR: Zuerst sollten wir im Blick behalten, dass es sich um längerfristige Veränderungen handelt. Schaut man heute auf die großen Stellenportale, scheinen die Jobprofile von einer gewissen Konstanz zu sein. Die gern zitierten 4Ds (Demografie, Digitalisierung, Dekarbonisierung und Dezentralisierung), sorgen für schleichende und zugleich widersprüchliche Prozesse, die vermutlich erst im Rückblick von 2030 oder sogar später als eindeutige Veränderungskurven nachgezeichnet werden können. Erst dann zu reagieren wäre allerdings fatal. Daher müssen bereits heute die Unternehmen ihre Beschäftigten auf die Workforce Transformation in ihren sehr unterschiedlichen Facetten vorbereiten. Dazu gehört auch die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden für ihre Weiterbildung zu stärken, um attraktiv für den Arbeitsmarkt zu bleiben.
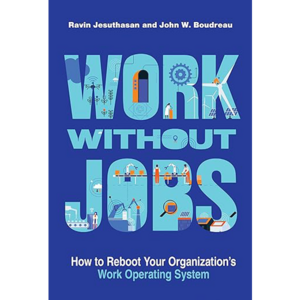
Weitere Informationen zum Buch
„Work without Jobs: How to Reboot Your
Organization’s Work Operating System“
gibt es hier.
RN: Wie können Unternehmen und Beschäftigte aus Ihrer Sicht mit der Entwicklung Schritt halten?
SvR: Dafür gibt es kein Patentrezept. Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Ein wichtiger Schritt ist, die heutigen Jobprofile mit den sich verändernden Prozessen und Strukturen der Wertschöpfung zu synchronisieren. Bestimmte Jobprofile wie z. B. im Kundenservice werden sich aufgrund KI und weiterer Technologien schneller und radikaler verändern als in der Produktion und Instandhaltung. Dazu ist es notwendig, die formellen wie auch die informellen Skills der Mitarbeitenden zu kennen. Mitarbeitende haben viele Fähigkeiten, die in ihrem aktuellen Job gar nicht zum Tragen kommen, aber viel Potential für neue Aufgaben bergen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels ist es wichtig, dieses Knowhow für den heutigen Arbeitgeber oder beispielweise für ein Unternehmen, das vielleicht gerade jetzt gegründet wird, zu erschließen.
Trend 2: Von der Automatisierung menschlicher Arbeit zur Nahtstelle Mensch und Technologie
RN: Sie haben es bereits angesprochen: Automatisierung, Digitalisierung und aktuell auch KI-Systeme verändern menschliche Arbeit massiv. Welche Entwicklungen sollten Unternehmen in diesem Kontext besonders im Auge behalten?
SvR: Im Vergleich zu den Entwicklungen seit den 1990er Jahren, die sehr stark zur Automatisierung von Arbeitsplätzen im Blue Collar Bereich geführt haben, greift KI tief in die Wertschöpfung in hochwertigen White-Collar Profilen ein. Wir können heute noch nicht voraussagen, ob die Tendenz der Ersetzung (engl.: Automation) oder der Verstärkung (engl.: Augmentation) dominieren wird. Was wir aber schon beobachten, ist die Entstehung einer Nahtstelle, an der Mensch und Künstliche Intelligenz gemeinsam und dauerhaft interagieren. Diese unterscheidet sich radikal von der Schnittstelle Mensch und Computer, die uns seit den 1980er Jahren vertraut ist. Damit entsteht ein neuer permanenter Anpassungsdruck für Unternehmen wie Arbeitnehmer. Es gilt die Mitarbeitenden im Umgang mit den neuen Technologien so zu qualifizieren, damit sie das Potenzial und die Chancen sowohl zur Steigerung der Wertschöpfung wie zur Verbesserung der persönlichen Employability nutzen.
TIPP:
Schauen Sie sich jetzt die Aufzeichnung der Panel-Diskussion zu den Herausforderungen und Chancen an der Nahtstelle von Mensch und Künstlicher Intelligenz an.
Finden Sie jetzt mit dem KI-Check unseres Kooperationspartners ONESTOPTRANSFORMATION (kostenfrei bis Ende Januar 2024) heraus, wie es um Ihre KI-Kompetenz steht!
Neben diesen Chancen muss man aber auch im Blick behalten, dass durch KI und Co. künftig in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze wegfallen werden. Technologische Arbeitslosigkeit auf der einen und Arbeiterlosigkeit aufgrund des Fachkräftemangels sind also parallele Trends, mit denen sich Unternehmen in nächsten Jahren auseinandersetzen und idealerweise frühzeitig gegensteuern sollten.
RN: Was raten Sie Unternehmen? Wie kann dies gelingen?
SvR: Wichtig ist ein permanenter Abgleich mit Anforderungen des Marktes – welche Kompetenzen brauchen Unternehmen? Wie entwickeln sich die technologischen Anforderungen? Wie kann ein Unternehmen seine Workforce transformieren? Und wie kann sich der Einzelne weiterentwickeln, um den Anforderungen gerecht zu werden? Mit anderen Worten es geht darum, in regelmäßen Abständen, Perspektiven aufzuzeigen und gemeinsam mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin individuelle Wege dorthin zu entwickeln.
Trend 3: Vom festen Betrieb zum fluiden Unternehmen innerhalb eines Ökosystems
RN: Nicht nur fixierte Jobprofile verlieren an Bedeutung. Auch Unternehmensstrukturen müssen flexibler werden – hin zu fluiden Unternehmen innerhalb von Ökosystemen ist eine weitere Trend-These. Sehen Sie hier in Deutschland bereits erste Anzeichen?
SvR: In Deutschland sind wir immer noch sehr stark davon geprägt, dass ein Betrieb einen festen Ort hat, der auch physisch wahrgenommen werden kann, z. B. ein großes Werksgelände oder die Büroetage einer Firma. Und auch das Arbeitsrecht setzt aktuell noch sehr starke Grenzen. Die meisten Konzerne, die schon länger in globalen Matrix-Strukturen arbeiten, setzen sich mit der Herausforderung bereits intensiver auseinander. Aber auch mittelständische Firmen und KMUs müssen sich mit der Flexibilisierung von betrieblichen Strukturen und dem Hineinwachsen in vielgestaltige Ökosysteme von Wertschöpfung deutlich mehr beschäftigen. Hier benötigen Führungskräfte und Beschäftigte Hilfestellungen, um sich in einer radikalen veränderten Arbeitswelt zu orientieren.

Trend 4: Vom Stelleninhaber zur ganzheitlichen Mitarbeiterpersönlichkeit
RN: Ein neuer Blick auf die Zusammenarbeit mit und das Potenzial von Beschäftigten ist auch gefordert, um Mitarbeitende nicht als Stelleninhaber, sondern als ganzheitliche Mitarbeiterpersönlichkeit zu betrachten. Wo liegt der Unterschied?
SvR: Das Bild des Stelleinhabers ist im Wortsinn eng mit der Stelle verknüpft, die der oder die Mitarbeitende aktuell bekleidet. In der Konsequenz bedeutet dies: Wird die Stelle durch Reorganisation, Restrukturierung oder ähnliches aufgelöst oder verlagert, wird der Stelleninhaber in der Regel nicht mehr gebraucht und muss das Unternehmen verlassen.
Bei dieser Betrachtung wird außer Acht gelassen, dass die meisten Beschäftigten über mehr Kompetenzen und Potenziale verfügen als sie in ihrer aktuellen Stelle einsetzen und zeigen können. Im Sinne einer nachhaltigen, langfristigen Personalstrategie und Zukunftssicherung von Unternehmen sollte sich der Blick auf die Beschäftigten im Sinne der Ganzheitlichkeit verändern.
RN: Wie können Unternehmen den Blick entsprechend weiten?
SvR: Die Personalstrategien sollten sich darauf konzentrieren, die individuellen Fähigkeiten und das Potenzial der Mitarbeiter zu erkennen und zu fördern. Dies bedeutet, Talentmanagement und Personalentwicklung so zu gestalten, dass sie die Persönlichkeit des Mitarbeiters umfassender als heute berücksichtigen. Erst wenn die Potenziale der heutigen Mitarbeitenden mit den Future Skills der Wertschöpfung von Morgen abgeglichen werden, lassen sie sich für neue Aufgaben im Unternehmen gewinnen. Unternehmen, die das Mindset des Verändern-Wollens und Verändern-Könnens bei ihren Beschäftigten langfristig fördern, werden hier deutlich erfolgreicher sein.
Stellen Sie die richtigen Fragen
Gehen Sie der Frage Ihres Personalbestands und -bedarfs auf den Grund. Hinterfragen Sie die Geschäftsziele und deren Verzahnung mit der Personalstrategie.
Trend 5: Von der Management-Hierarchie zur dezentralen Steuerung von Unternehmen
RN: Zum Abschluss, wie schätzen Sie den Trend von der traditionellen Management-Hierarchie zur dezentralen Steuerung von Unternehmen ein?
SvR: Dieser Trend ist gar nicht mehr so neu, denn wir beobachten hier schon länger Veränderungen, die in Unternehmen auf vielen Ebenen stattfinden. Agilität ist hier ein wichtiger Ansatz. Viele Unternehmen haben verschiedenste Formen von agiler Führung, agilen Unternehmensstrukturen und agiler Organisation ausprobiert. Um langfristig erfolgreich zu sein, sind neue Formen der Kooperation zwischen Management, den verschiedenen Bereichen im Unternehmen sowie der Organisations- und Führungskräfteentwicklung entscheidend, sowie eine Führungskultur, die die dezentrale Steuerung unterstützt. Auch hier gibt es keine Lösungsschablonen, um unter zunehmendem Anpassungsdruck von neuen Technologien und beschleunigten Märkten zu bestehen. Früher konnten Unternehmen dank größerer Organisation von geringeren Transaktionskosten profitieren. Aufgrund Echtzeit-Kommunikation, Partner-Plattformen und entstehender Ökosysteme werden diese einstigen Vorteile zunehmend nivelliert. Damit wird die traditionelle Management-Hierarchie zu langsam und zu teuer. Aber es geht hier nicht um das willkürliche Experimentieren mit revolutionär klingenden Ideen wie z. B. der holistischen Unternehmensorganisation. Wir brauchen ein evolutionäres Weiterentwickeln von Strukturen und Prozessen, die zum jeweiligen Unternehmen, seinen Beschäftigten, Kunden, Partnern, Lieferanten usw. passen und tatsächlich zur Zukunftssicherung beitragen.
Meine Empfehlung: weniger Heißluftballons mit bunten Slogans, sondern mehr Zupacken in der täglichen Arbeit, echtes Vertrauen in Führungskräfte und Mitarbeitende sowie ehrlicher Austausch über Schwächen und Verbesserungspotenziale.
Über die Interviewpartnerin

Chief Executive Officer
Sophia von Rundstedt ist eine der führenden Expertinnen für Workforce Transformation in DACH. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der gleichnamigen Beratung für Personalveränderung, die ihr Vater vor mehr als 35 Jahren gegründet und im Outplacement zum deutschen Marktführer gemacht hat. Von Rundstedt berät Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung von Personalumbau und -abbau und hat bis heute mehr als 500 Projekte erfolgreich begleitet. Sophia von Rundstedt wird von der Überzeugung angetrieben, dass in jeder Veränderung eine große Chance liegt.
